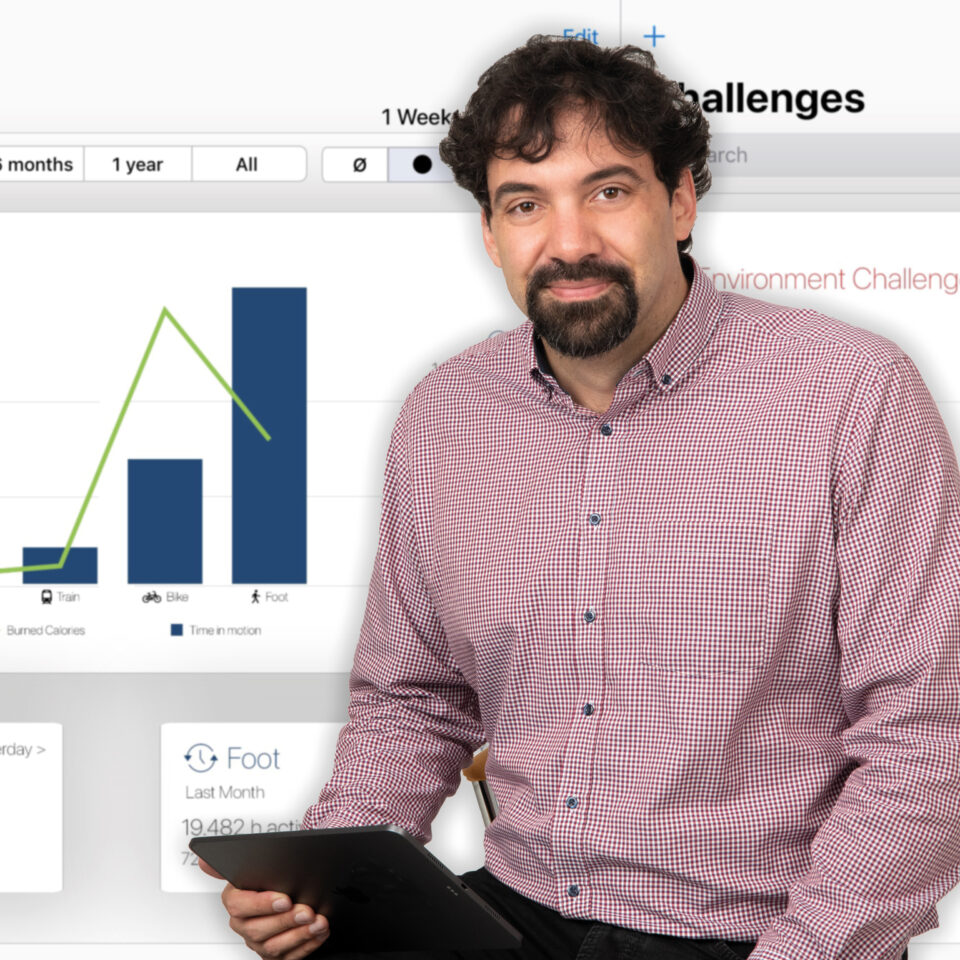Prof. Stephan Jonas im Interview
Prof. Stephan Jonas leitet das neue Institut für Medizininformatik am UKB. Im Rahmen der neuen Professur will der 38-jährige Informatiker erforschen, wie medizinisch relevante Patientendaten digital erhoben, analysiert und für Studien bzw. klinische Abläufe nutzbar gemacht werden können. Er sieht hier eine effiziente Verfahrensweise, die Versorgung von Patient*innen noch weiter zu verbessern und zu individualisieren. Dabei hat er auch die datenschutzkonforme und privatsphärenschonende Verarbeitung von Daten im Blick.
Es gibt mittlerweile über 100.000 Gesundheitsapps auf dem Markt. Freuen Sie sich über diese Entwicklung?
Natürlich ist es schön zu sehen, dass das Thema Gesundheit auf den Smartphones und damit im Alltag einen großen Stellenwert einnimmt. Andererseits bedeutet die Aufnahme in einen App-Store noch nicht, dass eine App wirklich wirksam ist, also ob das versprochene Ziel mit der App auch erreicht werden kann. Nicht erst seit der Bier-Diät weiß man, dass nicht alles gesund ist, nur weil man es in diesen Kontext stellt. Ebenso verhält es sich mit Apps. Die jeweiligen Anbieter sind zunächst gewinnorientiert, also meistens an Kundendaten oder zahlenden Kunden und damit Kundenbindung interessiert. Das lässt sich aber häufig nicht damit vereinbaren, dass sich aus Ernährungsumstellung oder Fitnessplänen direkte Einschränkungen ergeben, die oft ein hohes Maß an Disziplin benötigen.
Woran erkenne ich, ob eine App seriös ist? Gibt es allgemeingültige Standards und Qualitätsvorgaben für deren Entwicklung?
Es gibt derzeit leider kein allgemeingültiges Gütesiegel oder Qualitätsmerkmal für Gesundheitsapps. Lediglich die Zulassung als Medizinprodukt ist ein klares Qualitätsversprechen, sowohl was die Wirksamkeit als auch die Qualität der Umsetzung angeht. Die Zulassung haben aber bisher nur die wenigsten Applikationen und diese sind in der Regel auf sehr spezifische Anwendungen reduziert. Man kann jedoch häufig anhand der Hersteller und deren Kooperationen erkennen oder zumindest vermuten, ob es sich um ein qualitativ hochwertiges Produkt handelt – genauso wie bei anderen Produkten. Ein namhafter Konzern geht in der Regel nicht das Risiko ein, den eigenen Namen für ein minderwertiges Produkt zu riskieren. Ebenso können Kooperationen mit großen wissenschaftlichen Einrichtungen in der Entwicklung ein Hinweis sein, dass eine wissenschaftlich fundierte App entwickelt wurde.
Gibt es mittlerweile verlässliche Studien zur Wirkung und zum Nutzen von Gesundheitsapps? Was besagen diese?
Die meisten Studien zu Gesundheitsapps betrachten nur kurzfristige Ergebnisse, beispielsweise, ob ein bestimmtes Ziel innerhalb weniger Wochen oder Monate erreicht wurde. Zum langfristigen Nutzen von Gesundheitsapps gibt es wenige belastbare Studien. Fitnessapps wollen ja auch häufig eher präventiv arbeiten, also in der Vermeidung von Erkrankungen. Ein solches Ziel ist kurzfristig quasi nicht nachweisbar, weil man erst im hohen Alter feststellen wird, ob die Kardioprävention mit dem Fitnessarmband gewirkt hat. Hier muss man sich häufig auf bisherige Erfahrungen verlassen und beispielsweise etablierte Maßnahmen als App digitalisieren.
Es wird immer noch bemängelt, dass es zu wenige Apps für die Menschen mit Behinderungen und Funktionseinschränkungen gibt. Ist das so? Und wenn ja, warum?
Wer nur einmal aufgrund einer Operation mit Krücken unterwegs war, wird schnell feststellen, dass die Welt selbst bei geringen körperlichen Leiden schwieriger zu navigieren wird. Wie sich dies für Personen mit echten körperlichen oder geistigen Einschränkungen anfühlen muss, lässt dies nur erahnen. Leider verhält es sich sehr ähnlich im Bereich der mobilen Applikationen. Die Hersteller der gängigen Betriebssysteme haben zwar häufig sogenannte Accessibility Features, also Funktionen um Texte vorzulesen oder das Handy im Allgemeinen einfacher bedienbar zu machen, jedoch endet in der Regel die Unterstützung für eingeschränkte Personen bereits damit. Es gibt zwar Applikationen, die beispielsweise rollstuhlgerechte Navigation anbieten, oder die speziell für Senioren gemacht wurden. Dennoch sind diese ein geringer Bruchteil der App-Landschaft. Einen einzelnen Grund dafür zu benennen ist schwierig. Es handelt sich hierbei wahrscheinlich um eine Gemengelage. Der erste Grund sind die vielen, kleinen Zielgruppen, da beispielsweise viele Beeinträchtigungen Speziallösungen benötigen. Zudem wird die Kaufkraft in diesen Gruppen in der Regel geringer eingeschätzt. Und zuletzt ist die Präsenz von Menschen mit Einschränkungen auch bei den Entwicklern oft nicht gegeben.
Welche Apps haben Sie schon (mit)entwickelt?
Unsere Entwicklungen sind hauptsächlich im Bereich der Forschung angesiedelt und somit nicht über den App-Store verfügbar. Dennoch haben wir gemeinsam mit größeren Unternehmen mobile Applikationen entwickelt, aber auch mit Startups oder wie derzeit mit der Deutschen Hochdruckliga und der deutschen Herzstiftung eine Applikation zur Erhaltung der Herzgesundheit.
Welche aktuellen Projekte zu den Gesundheitsapps koordinieren Sie derzeit?
Das oben angedeutete Projekt mit der Deutschen Hochdruckliga und der Deutschen Herzstiftung ist sicherlich das prestigeträchtigste Projekt, an welchem wir derzeit arbeiten. Wir haben jedoch auch kürzlich eine Studiensoftware für die Klinik und Poliklinik für Epileptologie am UKB entwickelt, die wir in naher Zukunft in einer Studie pilotisieren möchten. Zudem arbeiten wir gemeinsam mit der Carl Zeiss AG an mehreren Projekten zu mobilen Applikationen in der Bewegungsanalyse für die Neurorehabilitation sowie im Bereich der Augenheilkunde.
Was glauben Sie, wie wird sich die Gesundheitsapp-Landschaft weiter verändern? Welche Trends werden kommen?
Durch die neuen Gesetzeslagen und die “App auf Rezept”, also die Digitalen Gesundheitsanwendungen (DIGA) oder Digitalen Pflegeanwendungen (DIPA), werden sich mobile Applikationen deutlich mehr in der Diagnose, der Therapie und vor allem der Langzeitverfolgung von Erkrankungen oder Begleitung der Pflege etablieren. Auch werden die immer neuen Sensoren in Smartphones und anderen körpernahen Geräten (Fitnesstracker, Smart Watches etc.) dazu führen, dass wir in Zukunft viel mehr Daten über uns selbst erheben werden. Und was man nicht vernachlässigen darf: Alleine dass ich als Laie durch das Nutzen von Gesundheitsapps zur Inspiration oder Information ein besseres Verständnis für meinen Körper, meiner Physis und meiner Psyche entwickle, ist ein Grund sehr optimistisch in die Zukunft zu schauen.
Wie kann man die Apps in den klinischen Alltag einbauen? Wie würden die Apps das Tagesgeschäft einer Pflegekraft und einer Ärztin oder eines Arztes verändern?
Das einfachste Beispiel ist hier die Kommunikation: Wer würde sich nicht wünschen, einfach mit den Kollegen über einen Messenger Informationen oder Daten zu einer Patientin oder einem Patienten auszutauschen? Mit einem Wischen auf dem Smartphone die letzten Laborbefunde oder Therapiepläne aufzurufen während man am Bett steht oder im Patientengespräch ist, wäre sicherlich wünschenswert. Dazu könnten Apps helfen zu verstehen, wie Personen sich außerhalb der Klinik verhalten. Bewegt sich die orthopädische Patientin auch wirklich so viel, wie sie sollte oder folgt der Krebspatient seinem Ernährungsplan? Was ist der durchschnittliche Puls meines Herzinfarktpatienten sechs Monate nach der Entlassung? Durch mobile Apps könnten solche Daten einfach und unaufdringlich durch die Patientinnen und Patienten erhoben werden.