Drei vom BONFOR-Programm der Medizinischen Fakultät Bonn geförderte Nachwuchs-Forschende reden über ihren wissenschaftlichen Einstieg
Vielversprechende junge Menschen beim Start in ihre akademische Karriere unterstützen – das ist das Ziel des Förderprogramms BONFOR der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn. Dieses Jahr wurden wieder die sieben besten Projekte aus BONFOR und dem darin angedockten SciMed-Promotionsstipendium mit insgesamt 4.400 Euro ausgezeichnet. Drei Geförderte sprechen mit UKBmittendrin über ihre Forschung und Motivation.
Potentiale der Bluthirnschranke
Dr. Amira Hanafy (BONFOR-Preis) von der Klinik für Neurochirurgie des UKB beschäftigt sich in der Arbeit „Striatal blood-brain barrier: perinatal permeability fluctuations“ mit der Blut-Hirn-Schranke (BHS), die das Gehirn vor potenziell schädlichen Stoffen im Blut schützt. Lange Zeit nahm man an, dass sie sich bei Embryonen erst spät entwickelt. In dem Projekt wollte die Forscherin herausfinden, wann genau die BHS im sich entwickelnden Gehirn – insbesondere im Striatum, eine Kerngebiet des Vorderhirns – funktionell „dicht“ ist, also Moleküle nicht mehr unkontrolliert passieren lässt. Mithilfe eines neu entwickelten Mikroperfusionsmodells untersuchte sie Hirnschnitte von Mäusen vom Embryo bis zum jungen Erwachsenenalter und beobachtete in Echtzeit, wie stark verschiedene Moleküle aus den Blutgefäßen ins Hirngewebe eindringen konnten.
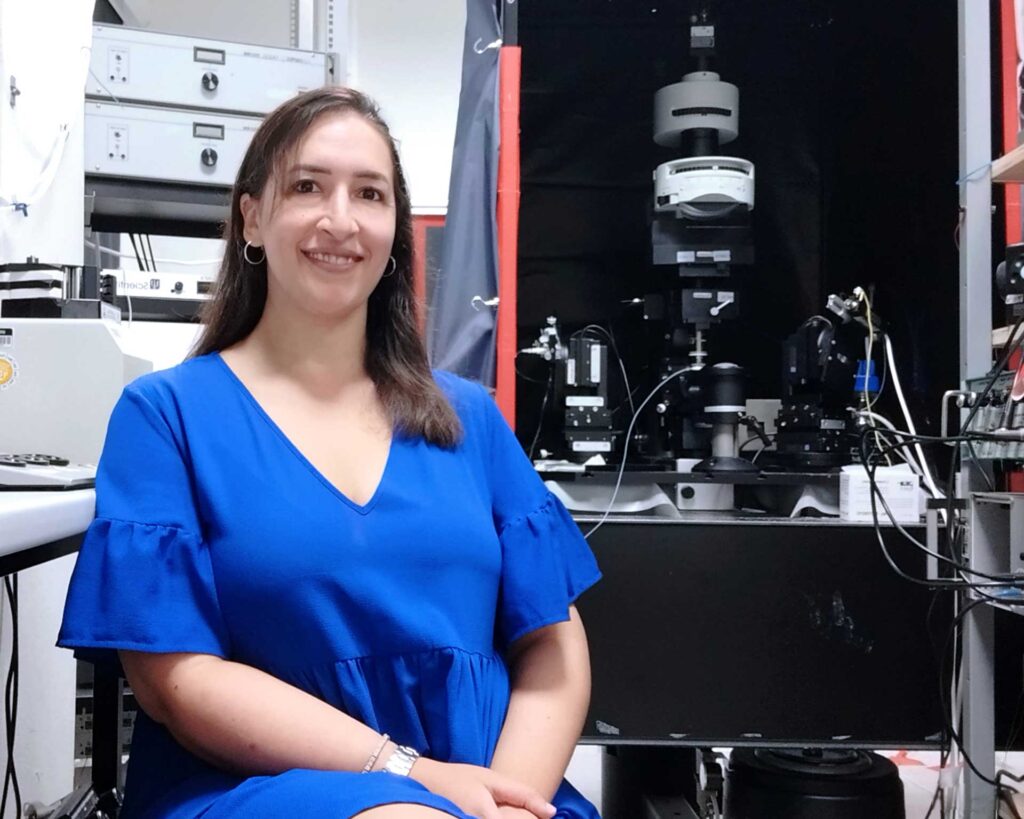
Dr. Amira Hanafy (BONFOR-Preis), Bildnachweis: privat
Frau Dr. Hanafy, was war Ihre Motivation für das Projekt?
Dr. Amira Hanafy: „Aus einem tiefen wissenschaftlichen Interesse heraus, wollte ich besser verstehen, wann und wie die BHS das sich entwickelnde Gehirn zu schützen beginnt. Diese Frage ist medizinisch von großer Bedeutung, insbesondere für die Entwicklung sicherer Therapien während Schwangerschaft und Neugeborenenzeit. Mit der Forschung wollen wir unter anderem den Zeitpunkt der funktionellen Reifung der embryonalen BHS bestimmen und der Frage nachgehen, wann das fetale Gehirn vor maternalen Substanzen effektiv geschützt ist Zudem bestehen große Wissenslücken bezüglich der molekularen Mechanismen und zeitlichen Dynamik der BHS-Entwicklung.“
Was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse und Zukunftsvision?
Dr. Amira Hanafy: „Die BHS ist im Embryo bereits erstaunlich dicht, öffnet sich jedoch unmittelbar nach der Geburt vorübergehend – speziell im Striatum, das wichtige motorische und kognitive Aufgaben steuert. Diese natürliche „Öffnung“ könnte als therapeutisches Zeitfenster genutzt werden, um gezielt Medikamente oder Antikörper ins Gehirn Neugeborener zu bringen. Besonders für Erkrankungen, die im Neugeborenenalter auftreten oder sich später im Leben entwickeln, könnten so neue Behandlungsstrategien entwickelt werden. Obwohl das jetzt ausgezeichnete Projekt abgeschlossen ist, ist mein wissenschaftliches Interesse an der Bluthirnschranke ungebrochen. Daher habe ich vor in einem eigenen Forschungsprojekt neue Behandlungsansätze für Alzheimer zu entwickeln, basierend auf bislang unbeachteten Eigenschaften der Blut-Hirn-Schranke.“
Neue Waffen gegen Gelbfieber
Dr. Philipp Schult: (BONFOR-Preis) vom Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie beschäftigt sich in seiner Arbeit „The impact of epitranscriptomic RNA modification on the flavivirus life cycle“ mit der Frage, wie chemische Modifikationen an der RNA den Replikationszyklus des Gelbfiebervirus beeinflussen. Diese Veränderungen kommen in der Zelle natürlicher Weise vor und tragen unter anderem dazu bei, dass zelleigene RNAs nicht vom Immunsystem erkannt werden.

Dr. Philipp Schult (BONFOR-Preis), Bildnachweis: privat
Herr Dr. Schult was interessiert Sie an diesem Thema besonders?
Dr. Philipp Schult: „Ich fokussiere mich bei meiner Arbeit auf ein Enzym, dem NSUN2, welches für einen Teil der Modifikationen zellulärer mRNAs verantwortlich ist und auch an virale RNA bindet. Mittels knock-out Zellen und chemischer Inhibitoren versuche ich die Funktion dieses Enzyms in der viralen Replikation zu verstehen.“
Was ist dabei Ihr Ziel?
Dr. Philipp Schult: „Die Motivation dieses Projektes ist letztlich, potentielle Angriffspunkte für antivirale Therapeutika zu finden. Hierzu muss die Interaktion zwischen Wirt und Virus gut verstanden sein, wozu mein Projekt hoffentlich beitragen kann. Denn Gelbfieber ist ein Virus, welches sich gerade in den letzten Jahren immer weiter auch in vormals nicht betroffene Regionen ausbreitet. Daher wird trotz einer effektiven Impfung die Verfügbarkeit von wirksamen Behandlungsoptionen wichtig werden. Zudem sind einige Verwandte in der Virusfamilie wie ZIKA und Dengue ebenfalls relevant und haben einige Gemeinsamkeiten in ihrem Lebenszyklus. Daher könnten therapeutische Ansätze für Gelbfieber für diese Viren ebenfalls effektiv sein.“
Möglicher Paradigmenwechsel bei Epilepsie
Nina Rebecca Held (1. SciMed-Preis) von der Klinik für Epileptologie sowie der Klinik für Neuroradiologie des UKB untersucht in der Arbeit „Quantitative susceptibility mapping reveals post- and interictal iron accumulation in focal epilepsy“, ob und wie sich Eisen im Gehirn von Menschen mit Epilepsie ablagert und welche Zusammenhänge es dabei zu Anfällen sowie zu typischen Begleiterscheinungen wie Gedächtnisproblemen oder depressiven Symptomen gibt. Möglich wird das durch ein besonders hochauflösendes MRT-Verfahren namens Quantitative Suszeptibilitäts-Mapping (QSM), das am 7-Tesla-MRT durchgeführt wird. Damit lassen sich Veränderungen im Eisenhaushalt des Gehirns sichtbar machen, und das völlig schmerzfrei und ohne Eingriff.

Nina Rebecca Held (1. SciMed-Preis), Bildnachweis: privat
Frau Held, was hat Sie dazu motiviert, dieses Thema zu erforschen?
Nina Rebecca Held: „Frühere Studien haben bereits gezeigt, dass die sogenannte Blut-Hirn-Schranke bei Epilepsie gestört sein kann und dass Eisen bei Entzündungsprozessen und Zellschädigung eine Rolle spielt. Langfristig möchten wir besser verstehen, was im Gehirn bei Epilepsie passiert – nicht nur während eines Anfalls, sondern auch dazwischen. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass nicht nur sichtbare Hirnläsionen, sondern auch ein Ungleichgewicht im Eisenstoffwechsel wichtig sind. Sollte sich das bestätigen, könnte dies einen Paradigmenwechsel einleiten: weg von der alleinigen Suche nach strukturellen Läsionen, hin zu einem metabolischen Verständnis epileptischer Anfälle.“
Welche Bedeutung könnte das für die Behandlung von Epilepsie haben?
Nina Rebecca Held: „Etwa ein Drittel der Menschen mit fokaler Epilepsie spricht nicht ausreichend auf Medikamente an. In solchen Fällen ist ein epilepsiechirurgischer Eingriff eine Option, sofern der Ursprungsort der Anfälle möglichst genau bestimmt werden kann. Hier könnte QSM künftig eine zusätzliche Methode sein, um diesen Ort sichtbar zu machen – vor allem bei Betroffenen, bei denen man in herkömmlichen MRT-Bildern keine klare Ursache findet. Auch als nicht-invasiver Marker für die individuelle Anfallslast könnte QSM eine Rolle spielen. Noch ist das Zukunftsmusik, doch erste Ergebnisse stimmen vorsichtig optimistisch. Für mich bedeutet Forschung nicht nur Erkenntnisgewinn, sondern auch Verantwortung: Im besten Fall kann sie einen kleinen Beitrag dazu leisten, das Leben von Menschen mit Epilepsie zu verbessern.“
Bild Links: AG Translationale Neurobildgebung (Leitung von PD Dr. Theodor Rüber), Bildnachweis: Volker Lannert




